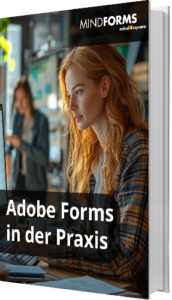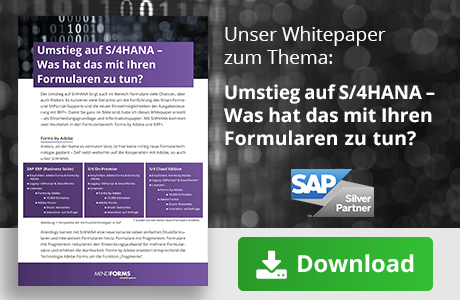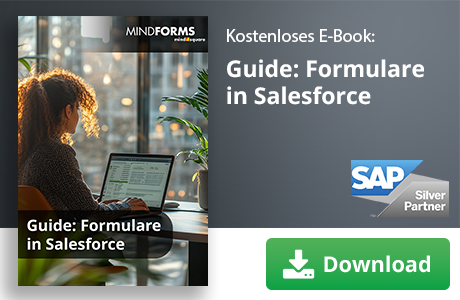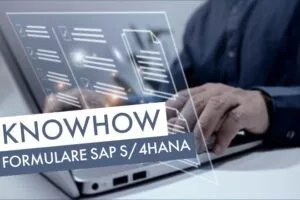Namenskonventionen in SAP-Formularprojekten
Inhaltsverzeichnis
- Das Wichtigste im Überblick
- Was sind Namenskonventionen?
- Warum sind Namenskonventionen so hilfreich?
- 4 typische Fehler und wie Sie diese vermeiden
- Typische Konventionen im SAP-Kontext: Welche Namenskonventionen sollten Sie wählen?
- Vom Chaos zur Klarheit: Wie Sie Namenskonventionen erfolgreich einführen
- Nützliche Tools für Namenskonventionen
- Fazit
- FAQ
Das Wichtigste im Überblick
- Relevanz von Namenskonventionen: Einheitliche Regeln für die Benennung von Objekten Formularen in der SAP verhindern Chaos, erhöhen die Wartbarkeit und verbessern die Qualitätssicherung.
- Vorteile durch klare Benennungen: Einheitliche Namen erleichtern die Wiedererkennbarkeit, verbessern die teamübergreifende Zusammenarbeit, reduzieren Suchaufwände, Fehler und erhöhen die Effizienz bei Korrekturen und Erweiterungen.
- Fehlerquellen und Best Practices: Häufige Fehler sind fehlende Definitionen, inkonsistente Anwendung, zu komplexe oder zu generische Namen und fehlende Dokumentation. Erfolgreiche Einführung erfordert eine frühzeitige Festlegung und kontinuierliche Schulung.
- Praktische Umsetzung und Tools: Der Einsatz von Tools wie Linter, Formatter und statischer Codeanalyse hilft, Namenskonventionen durchzusetzen und Verstöße automatisch zu erkennen. Ein strukturierter Ansatz zur Einführung und Dokumentation ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.
Was sind Namenskonventionen?
Namenskonventionen sind definierte Regeln zur Benennung von Objekten in der Softwareentwicklung. In SAP-Formularprojekten betrifft das u.a. Formularnamen, Schnittstellen, Textbausteine, Variablen, Felder und Druckprogramme.
Warum sind Namenskonventionen so hilfreich?
Einheitliche Namenskonventionen ergeben in Organisationen jeder Größe Sinn und sind ab einer gewissen Größe dringend zu empfehlen. Aus vielen Gründen. Hier die vier aus unserer Sicht wichtigsten:
- Wiedererkennbarkeit: Entwickler erkennen sofort, um welche Art Objekt es sich handelt – ohne Dokumentationen wälzen zu müssen. Das spart Zeit im Alltag und vereinfacht die Abstimmung im Team.
- Teamübergreifende Zusammenarbeit: Neue Teammitglieder oder externe Partner finden sich schneller zurecht. Das steigert die Effizienz und vereinfacht Übergaben.
- Wartbarkeit: Korrekturen oder Erweiterungen lassen sich schneller und sicherer umsetzen. Denn Entwickler müssen keine aufwändigen Suchläufe starten, die häufig das Risiko von Fehlern erhöhen.
- Qualitätssicherung: Bei Test- und Freigabeprozessen reduzieren Namenskonventionen Fehler, da sofort klar ist, welches Objekt welchen Zweck erfüllt. Das Ergebnis sind saubere, stabile Releases.
Praxisbeispiel aus dem Formularumfeld: Einführung der E-Rechnung
Ein Kunde hatte mehrere hundert Adobe Forms im Einsatz – ohne einheitliche Benennung. Bei der Einführung der E-Rechnung mussten relevante Formulare identifiziert und angepasst werden. Der manuelle Suchaufwand: enorm. Mit einer zuvor definierten Konvention hätte man gezielt nach z.B. “Z_FORM_XRECHNUNG_*” suchen können und viele Arbeitsstunden und damit Kosten eingespart.
4 typische Fehler und wie Sie diese vermeiden
In der Praxis begegnen uns immer wieder ähnliche Fehler beim Umgang mit Namenskonventionen in SAP-Formularprojekten:
1. Fehlende oder zu späte Definition
Viele Projekte starten ohne ein klares Namensschema. Oft mit dem Gedanken: „Das holen wir später nach“. Problematisch wird das, wenn erste Objekte bereits im Produktivsystem stehen.
Tipp: Definieren Sie Namenskonventionen vor dem ersten Transport – idealerweise schon in der Blueprint-Phase.
2. Inkonsistente Anwendung
Selbst gute Regeln nützen wenig, wenn sie nicht konsequent eingehalten werden. Unterschiedliche Teams oder externe Dienstleister verwenden oft eigene Muster.
Tipp: Verankern Sie Konventionen als Teil der Code-Reviews und im Projekt-Onboarding.
3. Zu komplexe oder zu generische Namen
Ein überfrachteter Name mit vielen Abkürzungen ist genauso problematisch wie ein nichtssagender wie „FORM1“.
Tipp: Setzen Sie auf klare, sprechende Namen mit strukturierter Lesbarkeit (z. B. durch Unterstriche) und verständliche Kürzel.
4. Keine Dokumentation oder Versionshistorie
Änderungen an Namensregeln werden häufig nicht nachgehalten, was zu Verwirrung führen kann.
Tipp: Pflegen Sie ein zentrales Dokument oder Wiki, in dem Konventionen versioniert und transparent dokumentiert sind.
Wenn Sie diese typischen Fehler vermeiden, schaffen Sie nicht nur Ordnung in Ihrem System, sondern stärken auch das Vertrauen in Ihre Entwicklungsqualität.
Typische Konventionen im SAP-Kontext: Welche Namenskonventionen sollten Sie wählen?
Zwar gibt es keine von SAP vorgeschriebenen Universalregeln, denen Sie strikt folgen müssen, jedoch gibt es im SAP-Umfeld bestimmte typische Benennungen, die Ihr Ordnungssystem inspirieren können.
Typisch im SAP-Kontext ist die Benennungen, die Präfixe für eigene Entwicklungen wie Z_ oder Y_ enthalten und dann einen Modul- oder Prozessbezug enthalten, zum Beispiel SD_, MM_, FI_. Zudem gibt es Verweise auf Versions- und Sprachkennzeichnung, beispielsweise _V1, _EN, und einen klaren Objektbezug: FORM_, INTF_, TEXT_, PGM_.
Für alle Entwickler, die in ABAP-Programmen arbeiten, gelten jedoch folgende Regeln zur Benennung:
- Maximale Länge: Ein Objektname darf bis zu 30 Zeichen lang sein.
- Erlaubte Zeichen: Zulässig sind die Großbuchstaben A–Z, die Ziffern 0–9 sowie der Unterstrich (_).
- Beginn des Namens: Ein Name muss mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen. Nur außerhalb von ABAP Objects kann ausnahmsweise ein anderes Zeichen am Anfang stehen.
- Namensraumpräfixe: Optional kann dem Namen ein Namensraumpräfix vorangestellt werden, zum Beispiel /XYZ/. Dieses Präfix besteht aus mindestens drei Zeichen, eingeschlossen von zwei Schrägstrichen. Wichtig: Die Gesamtlänge aus Präfix und Name darf 30 Zeichen nicht überschreiten.
- Reservierte Namen: Namen vordefinierter ABAP-Datentypen oder -Datenobjekte dürfen nicht erneut verwendet werden.
- Vermeidung reservierter Wörter: Auch wenn es technisch möglich ist, sollten Sie keine ABAP-Schlüsselwörter oder reservierte Begriffe als eigene Bezeichner verwenden. Davon wird aus Gründen der Lesbarkeit und Wartbarkeit dringend abgeraten.
- Besonderheit bei Feldsymbolen: Die Namen von Feldsymbolen müssen in spitze Klammern gesetzt werden (<…>). Diese Klammern sind Bestandteil des Namens, d. h. ein Feldsymbol könnte theoretisch < > heißen, was jedoch nicht empfohlen wird.
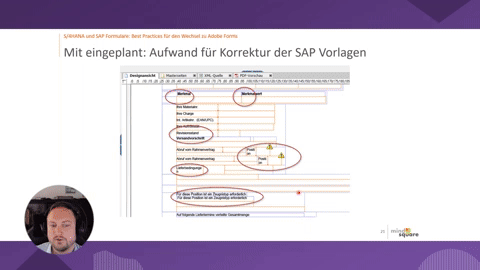
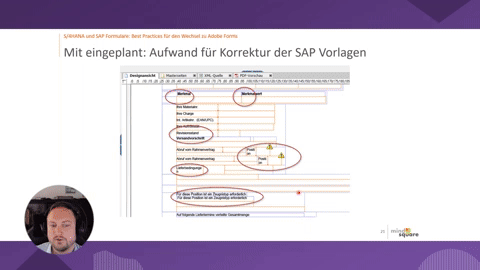
Vom Chaos zur Klarheit: Wie Sie Namenskonventionen erfolgreich einführen
Viele Unternehmen stehen vor dieser Herausforderung: Über Jahre hinweg wurden Dateien, Objekte oder Strukturen ohne klare Regeln benannt. Unterschiedliche Teams, externe Dienstleister und wechselnde Verantwortliche haben ihre eigenen Muster verwendet, oder gar keine. Doch auch in solche gewachsene Umgebungen lässt sich Struktur zurückbringen.
Bestandsaufnahme und Sichtung
Der erste Schritt sollte immer eine strukturierte Inventur sein:
- Welche Objekte, Dateien oder Komponenten existieren?
- Wie sind sie aktuell benannt?
- Welche sind aktiv im Einsatz, welche veraltet?
- Gibt es erkennbare Muster oder Redundanzen?
Machen Sie den Wildwuchs sichtbar, um dann gezielt einzugreifen.
Namenskonventionen definieren
Entwickeln Sie auf dieser Basis ein klar verständliches, praxisnahes Regelwerk:
- Was soll der Name aussagen (Inhalt, Typ, Projekt, Version)?
- Welche Elemente (Präfixe, Suffixe, Trennzeichen) sollen enthalten sein?
- Wie lang dürfen Namen sein?
- Welche Zeichen sind erlaubt?
- Wie wird mit bestehenden Systemgrenzen (z. B. max. 30 Zeichen) umgegangen?
Tipp: Binden Sie alle relevanten Rollen (IT, Dokumentation, Redaktion, Entwicklung, Fachbereich) mit ein. So sichern Sie Akzeptanz und Praktikabilität.
Chaos systematisch aufräumen
Statt einer kompletten Umbenennung empfiehlt sich ein stufenweiser, pragmatischer Ansatz:
- Neue Objekte und Dateien folgen sofort den neuen Regeln.
- Bestehende werden bei Änderungen oder Migrationen angepasst.
- Veraltete oder doppelte Einträge werden kategorisiert, dokumentiert oder archiviert.
- Bei kritischen Bereichen kann eine gezielte Umbenennungsaktion sinnvoll sein – unterstützt durch Skripte, Tools oder manuelle Prüfprozesse.
Governance etablieren
Damit die neuen Konventionen langfristig Wirkung zeigen, braucht es eine durchdachte Governance:
- Dokumentieren Sie die Regeln transparent, zum Beispiel in einem Wiki oder einem internen Styleguide.
- Schulen Sie alle Beteiligten in der Anwendung.
- Verankern Sie Naming-Checks in Freigabeprozesse oder automatisierten Prüfungen.
- Führen Sie regelmäßig Reviews durch, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen.
Kommunikation nicht vergessen
Ein häufiger Fehler: Die Namenskonvention wird irgendwo definiert, aber niemand kennt oder lebt sie. Deshalb:
- Kommunizieren Sie die Umstellung aktiv, damit wirklich alle betroffenen Mitarbeitenden Bescheid wissen.
- Erklären Sie das Warum: Zeitersparnis, Fehlervermeidung, Wiederverwendbarkeit sollen am Ende auch den Mitarbeitenden den Arbeitsalltag erleichtern.
- Zeigen Sie gute und schlechte Beispiele zur Orientierung.
Nützliche Tools für Namenskonventionen
Das beste Regelwerk nützt nichts, wenn es nicht gelebt wird. Genau deshalb sind Tools ein unverzichtbarer Baustein bei der Einführung und konsequenten Umsetzung von Namenskonventionen, unabhängig davon, ob Sie neue Projekte starten oder in bestehenden Strukturen aufräumen möchten.
Linter: Verstöße automatisiert erkennen
Linter sind Programme, die Quellcode oder andere Inhalte wie Konfigurationsdateien oder Stylesheets automatisch auf Regelverstöße prüfen. Einmal eingerichtet, erkennen sie sofort, ob ein Name zum Beispiel zu lang, zu kryptisch oder formal falsch ist. Je nach Umgebung stehen verschiedene Tools zur Verfügung:
- ESLint für JavaScript/TypeScript
- Checkstyle für Java
- Pylint für Python
- Stylelint für CSS/SCSS
- abapLint für ABAP-Systeme
Linter lassen sich direkt in der Entwicklungsumgebung integrieren oder in CI/CD-Prozesse einbinden. So wird die Einhaltung von Namenskonventionen zur automatisierten Qualitätsprüfung.
Formatter und Auto-Fixer: Konventionen automatisch anwenden
Wenn es nicht nur um die Erkennung, sondern auch um die automatische Umsetzung von Konventionen geht, kommen sogenannte Formatter ins Spiel. Diese Werkzeuge formatieren Code nach einheitlichen Vorgaben und können auch Namen anpassen – entweder vollständig automatisch oder halbautomatisch per Review.
Beispiele:
- Prettier für Webtechnologien
- Black für Python
- ABAP Cleaner für SAP-Umgebungen
Besonders beim nachträglichen Aufräumen gewachsener Strukturen sparen diese Tools enorm viel Zeit.
Statische Codeanalyse: Qualität ganzheitlich messen
Tools wie SonarQube, Teamscale oder Codacy gehen noch einen Schritt weiter: Sie analysieren ganze Codebasen auf Wartbarkeit, Komplexität, Sicherheit – und auch auf Namenskonformität. Verstöße lassen sich zentral darstellen, kategorisieren und nachverfolgen. Das ist besonders hilfreich in großen Teams oder bei mehreren Projekten parallel.
Typische Funktionen:
- Visuelle Dashboards
- „Technical Debt“-Bewertungen
- Trendanalysen
- Projektübergreifende Einhaltung von Standards
CI/CD-Integration: Konventionen technisch erzwingen
Durch die Einbindung in Continuous-Integration-Prozesse, zum Beispiel GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins oder Azure DevOps werden Namenskonventionen zur zwingenden Qualitätsanforderung:
Wer nicht korrekt benennt, kann nicht deployen.
Diese technische Integration ist eine gute Maßnahme, um die Einhaltung auch in agilen Projekten oder bei häufigen Releases konsequent sicherzustellen.
Dokumentation & Kommunikation: Transparenz und Akzeptanz schaffen
Neben technischen Tools braucht es auch eine gute Dokumentation der Namenskonventionen. Ob in einem zentralen Wiki, als Markdown-Datei im Repository oder als Schulungsunterlage, nur wenn alle Beteiligten die Regeln verstehen und anwenden können, erfüllen sie ihren Zweck.
Hier helfen:
- Confluence / Notion / SharePoint-Wikis
- Styleguide-Dokumente
- Namensgeneratoren oder Regel-Assistenten (z. B. für Azure-Ressourcen)
Fazit
Namenskonventionen sind kein Selbstzweck. Sie sparen Zeit, Geld und Nerven – besonders bei wachsenden Formularlandschaften. Die Einführung lohnt sich zu jedem Zeitpunkt, selbst wenn die Organisation viele Jahre mit unregulierten Benennungen gearbeitet hat. Es ist nie zu spät. Wichtig ist allerdings ein methodisches Vorgehen und die volle Unterstützung der Mitarbeitenden, damit die Namenskonventionen auch gelebt werden.
Für Letzteres können Tools eine wertvolle Hilfe sein: Sie können Regeln sichtbar machen, Verstöße erkennen und automatisch korrigieren und unterstützen, eine verlässliche Governance zu etablieren.
Websession: Namenskonventionen


Wenn Sie Fragen zu SAP-Namenskonventionen haben oder Ihre bestehenden Regeln evaluieren möchten, sprechen Sie uns gerne an. Unsere erfahrenen Experten unterstützen Sie individuell und praxisnah.
FAQ
Was sind Namenskonventionen?
Namenskonventionen sind definierte Regeln zur Benennung von Objekten in der Softwareentwicklung. Sie sorgen für den strukturierten Umgang mit verschiedenen Dokumenten, Schnittstellen und anderen Formularen.
Welche Best Practices gibt es für Namenskonventionen?
- Erstellen Sie ein verbindliches Namenskonzept-Dokument.
- Verankern Sie die Konvention in Ihrem Development Lifecycle.
- Schulen Sie Ihr Entwicklungsteam regelmäßig.
- Nutzen Sie Templates und Generatoren, die Namenskonventionen automatisch anwenden.
- Dokumentieren Sie Ausnahmen, um Sonderfälle nachvollziehen zu können.
Gibt es offizielle Namenskonventionen für SAP-Formulare?
Nein, SAP schreibt offiziell lediglich vor, dass Eigenentwicklungen wie kundenspezifische Formulare im Z‑Namensraum abgelegt werden. Darüber hinaus ist es Aufgabe des einzelnen Unternehmens, seine Formulare sinnvoll zu bezeichnen.
Wer kann mir beim Thema Namenskonventionen in SAP-Formularprojekten helfen?
Wenn Sie Unterstützung zum Thema Namenskonventionen in SAP-Formularprojekten benötigen, stehen Ihnen die Experten von Mindforms, dem auf dieses Thema spezialisierten Team der mindsquare AG, zur Verfügung. Unsere Berater helfen Ihnen, Ihre Fragen zu beantworten, das passende Tool für Ihr Unternehmen zu finden und es optimal einzusetzen. Vereinbaren Sie gern ein unverbindliches Beratungsgespräch, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.